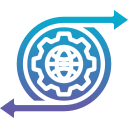Ethische Implikationen von KI im Gesundheitswesen bis 2025
Das Gesundheitswesen steht im Zuge der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) vor tiefgreifenden Veränderungen. KI wird zunehmend in Diagnose, Therapie und Patientenbetreuung integriert, was enorme Chancen, aber auch ethische Herausforderungen mit sich bringt. Bis 2025 dürften diese Technologien weitreichende Auswirkungen auf ärztliche Entscheidungsprozesse, das Arzt-Patienten-Verhältnis sowie auf Datenschutz und Fairness haben. Der verantwortungsvolle Einsatz von KI ist entscheidend, um das Wohl der Patientinnen und Patienten zu sichern und gesellschaftliches Vertrauen in diese Innovationen zu stärken. Umso wichtiger ist es, die ethischen Implikationen frühzeitig zu erkennen und in der Entwicklung sowie Anwendung von KI-Lösungen zu berücksichtigen.
Datenschutz und Datensouveränität
Herausforderungen der Datensicherheit
Kontrolle über persönliche Gesundheitsdaten
Transparenz in der Datennutzung
Verzerrungen in Trainingsdaten
Zugänglichkeit von KI-Lösungen
Überwachung und Evaluierung von Algorithmen
Verantwortung im medizinischen Entscheidungsprozess
Zusammenarbeit von Mensch und KI